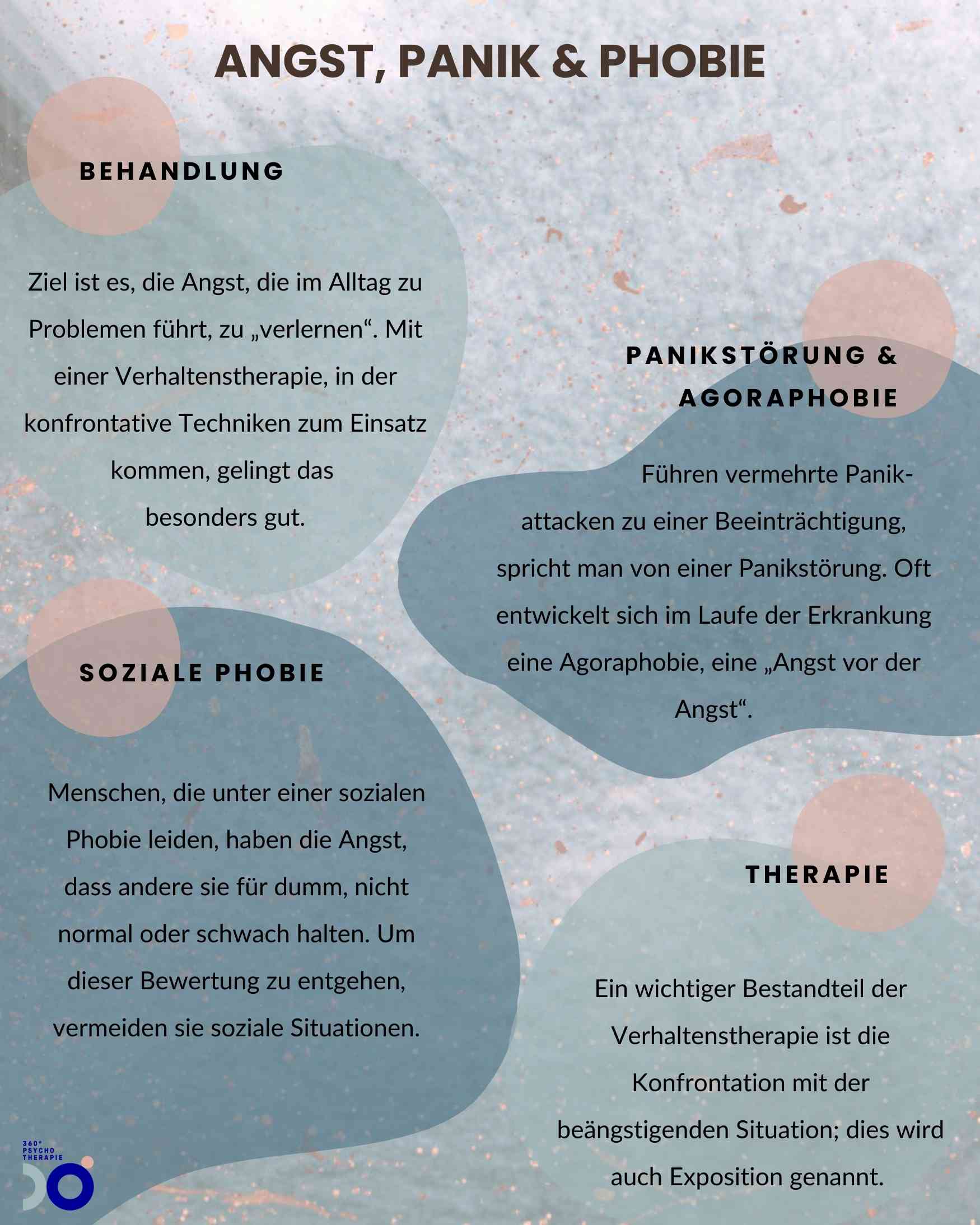Wie fühlt sich Angst an?
Angst, Panik und Phobie – Oftmals ein Engegefühl in der Brust, Schweißausbrüche, das Gefühl gleich ohnmächtig zu werden oder keine Luft mehr zu bekommen. Solche Symptome machen Patient:innen große Angst und sorgen nicht selten dafür, dass die Rettungsstelle aufgesucht wird. Ergibt die körperliche Untersuchung keine Auffälligkeiten, sind die Betroffenen meist sehr verunsichert. Wenn keine schlimme Krankheit vorliegt, was dann? Für viele ist es zunächst kaum vorstellbar, dass es sich bei solch schweren Symptomen um eine psychische Störung handeln kann. Tatsächlich können im Rahmen einer Angststörung heftige körperliche Symptome die z. B. einem Herzinfarkt ähnlich sein können, auftreten. Dabei kann sogar das Gefühl von Panik und Todesangst entstehen.
Der Sinn von Angst
Angst an sich ist nicht krankhaft, sie ist sogar sinnvoll. So erfüllt Angst eine wichtige Warnfunktion. Nehmen wir irgendwo Gefahr wahr, entsteht Angst. Dies ist eine wichtige Reaktion, um im Notfall entsprechend reagieren zu können. Begleitet wird das Gefühl der Angst von körperlichen Reaktionen. Die Muskeln spannen sich an, der Blutdruck steigt, der Körper wird in Alarmbereitschaft versetzt. Diese Bereitstellungsreaktion ist nötig, um vor drohendem Unheil rechtzeitig fliehen zu können – ein evolutionärer Vorteil.
Wenn Angst einschränkt
Jeder Mensch kennt Angst. Die Tendenz, auf bestimmte Reize so zu reagieren, ist eine Lernerfahrung. Im normalen Alltag ist dies bei tatsächlich drohender Gefahr, z. B. einem Brand, auch sinnvoll. Kommt es allerdings in alltäglichen Situationen, die für die meisten kein Problem darstellen, zu schwerwiegenden Reaktionen, liegt der Verdacht einer Angststörung nahe. Dabei reagieren Betroffene teilweise aus heiterem Himmel oder in bestimmten auslösenden Situationen mit Panik und fühlen sich dadurch in ihrem Alltag oft massiv eingeschränkt. Oft sind öffentliche Verkehrsmittel oder belebte Orte, wie z. B. Supermärkte ein Problem, die Betroffene dadurch häufig vermeiden. Viele schränken sich aus Angst vor einer erneuten Attacke selbst stark ein, was dazu führen kann, dass immer mehr Tätigkeiten im Alltag nicht mehr möglich sind. Oft ist das schließlich die Motivation, sich in therapeutische Behandlung zu begeben.
Ängste - Medikamente oder Verhaltenstherapie?
Ängste sind die am häufigsten berichteten Symptome in der Psychotherapie. Sie können als Symptome verschiedener Störungen aber auch als eigenständiges Krankheitsbild eine Rolle spielen. Trotz der oft heftigen Symptome sind Ängste sehr gut psychotherapeutisch behandelbar. Obwohl Patient*innen sich zunächst oft nach medikamentöser Therapie, z.B. nach „Beruhigungsmitteln“ erkundigen, bewirken diese oft das Gegenteil. Sie sollten daher nur im äußersten Notfall zum Einsatz kommen. Wichtiger ist, die Angstreaktion, die im Alltag zu Problemen führt, zu „verlernen“. Mit einer Verhaltenstherapie, in der konfrontative Techniken zum Einsatz kommen, gelingt das besonders gut. Dabei werden Patient*innen Schritt für Schritt mit therapeutischer Unterstützung an angstauslösende Reize gewöhnt. Auch wissenschaftlich ist der Nutzen einer Verhaltenstherapie sehr gut belegt, so dass Betroffenen durchaus Mut gemacht werden kann. Ängste lassen sich mit viel persönlicher Motivation sehr gut in den Griff kriegen.
Angsterkrankungen
Jeder hat schon einmal Angst verspürt. Angst ist wichtig, um uns vor Gefahren zu schützen und zu warnen. Sobald eine Situation als Bedrohung wahrgenommen wird, reagiert der ganze Körper, um auf die Gefahr reagieren zu können. Hierbei kommt es z.B. zu Herzrasen, Zittern, Schweißausbrüchen, Durchfall, Schwindel, Mundtrockenheit oder einem schnellen Atem.
Allerdings kann das Gefühl der Angst auch in Alltagssituationen auftreten, wenn objektiv keine Bedrohung vorliegt (z. B. beim Fahrstuhlfahren oder beim Anblick von Spinnen). Genauso können Gedanken oder körperliche Reaktionen starke Ängste hervorrufen. Wenn diese Ängste das Leben beeinträchtigen, spricht man von einer Angststörung. Angsterkrankungen gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. Etwa 10 % der Allgemeinbevölkerung sind davon betroffen.
Spezifische Phobie
Bei einer spezifischen Phobie tritt die Angst vor genau beschreibbaren Objekten oder Situationen auf. Dies betrifft häufig Tiere, Umweltphänomene (z.B. Wasser, Gewitter), den Anblick von Blut, Verletzungen oder Spritzen sowie spezielle Situationen (z.B. enge Räume, Zahnarzt). Wenn möglich, werden diese angstbesetzten Objekte oder Situationen vermieden. Bereits die Erwartung mit dem Objekt oder der Situation konfrontiert zu werden, kann eine Angstreaktion auslösen. Die Angst kann sich bis zu einem Panikanfall steigern. Obwohl Menschen mit einer spezifischen Phobie bewusst ist, dass die Angst unangemessen ist, können Sie die Angst nicht unterdrücken. Aus diesem Grunde vermeiden sie, wenn es möglich ist, angstauslösende Situationen.
Panikstörung und Agoraphobie
Während einer Panikattacke kommt es zu völlig unerwarteten intensiven Angstreaktionen, die von zahlreichen körperlichen Reaktionen begleitet wird. So spüren Menschen, die eine Panikattacke erleiden z.B. Atemnot, Brustschmerzen, Zittern, Herzklopfen, Schwindel, Schwitzen, Kribbeln in Armen oder Beinen, sowie Hitze- oder Kälteschauer. Aufgrund der starken körperlichen Reaktionen kommen viele Betroffene nicht auf die Idee, dass es sich um eine Angsterkrankung handeln könnte. Vielmehr befürchten Sie, dem Tode nahe zu sein, ohnmächtig zu werden, einen Herzinfarkt zu haben oder andere bedrohliche Folgen. Aus diesem Grund wird häufig der Notdienst oder Arzt aufgesucht.
Treten vermehrt Panikattacken auf und führen zu einer deutlichen Beeinträchtigung, spricht man von einer Panikstörung. Oft entwickelt sich im Laufe der Erkrankung eine Agoraphobie. Hierbei kommt es zu einer „Angst vor der Angst“. Es entwickelt sich die Befürchtung, eine Panikattacke in der Öffentlichkeit zu erleiden und nicht flüchten zu können oder nur unter schwierigen oder peinlichen Umständen aus der Situation zu kommen. Deswegen werden Menschenansammlungen, Reisen mit dem öffentlichen Nahverkehr, weite Plätze oder geschlossene Räume vermieden oder nur mit Begleitung aufgesucht.
Soziale Phobie
Eine Soziale Phobie äußert sich in der Befürchtung, die Aufmerksamkeit anderer Menschen auf sich zu ziehen, indem man sich ungeschickt oder peinlich verhält. Menschen, die unter einer sozialen Phobie leiden, haben die Angst, dass andere sie für dumm, nicht normal oder schwach halten. Um dieser Bewertung zu entgehen, werden soziale Situationen vermieden. Oft betrifft dies das Sprechen oder Schreiben in der Öffentlichkeit, das gemeinsame Essen oder die Teilnahme an Feiern und Konferenzen. Wenn eine Vermeidung nicht möglich ist, kommt es zu körperlichen Angstreaktionen, wie Erröten, Zittern oder Magen-Darmbeschwerden.
Generalisierte Angststörung
Kennzeichnend für eine generalisierte Angststörung sind viele Sorgen und Ängste über alltägliche Angelegenheiten. Die ständigen Sorgen führen zu einer Übererregung des Nervensystems. Dadurch kommt es zu Schlafstörungen, Muskelverspannungen, Unruhe oder Beklemmungsgefühlen. Die Sorgen treten in verschiedenen Situationen auf und betreffen mehrere Bereiche. Typische Gedanken sind: „Mein Partner verspätet sich. Ist ihm etwas passiert?“, „Ich könnte im Beruf etwas falsch machen!“, „Kann ich in Zukunft noch meine Rechnungen bezahlen?“ Menschen, die unter einer generalisierten Angststörung leiden, können diese Sorgen nicht bewusst abstellen. Zudem beginnt das sich Sorgen machen sehr schnell, z.B. beim Lesen eines Artikels über Verkehrsunfälle. Dabei werden schnell Katastrophenszenarien ausgemalt und von einer Sorge zur nächsten Sorge gesprungen. Um die Sorgen zu vermeiden, kommt es oft zur Rückversicherung. So wird z. B. der Partner angerufen, um nachzufragen ob alles in Ordnung ist oder Listen geführt, um nichts zu vergessen.
Therapiemöglichkeiten
Bei der Behandlung von Angststörungen, hat sich die Kognitive Verhaltenstherapie als besonders wirksam erwiesen. Ein wichtiger Bestandteil der Therapie ist die Konfrontation mit der beängstigenden Situation oder dem Objekt, was auch Exposition genannt wird. Dabei wird die angstauslösende Situation gezielt aufgesucht. Die Konfrontation kann schrittweise erfolgen oder es wird gleich mit der stärksten angstauslösenden Situation begonnen. Dabei werden alle Verhaltensweisen, die Sicherheit geben, unterlassen. Bei der Blut- und Verletzungsphobie wird vor der Konfrontation ein Verfahren (applied tension) eingeübt, um Ohnmachtsanfälle zu verhindern. Aber auch Verhaltensexperimente oder Umfragen sind ein häufig verwendetes Mittel in der Behandlung von Angststörungen.
ANGST, PANIK & PHOBIE
Psychologen und Psychotherapie bei Angst, Panik & Phobie